Rainer Merkel
wurde 1964 in Köln geboren, studierte Psychologie sowie Kunstgeschichte und lebt in Berlin. Häufig recherchiert er für Buch- und Zeitungsprojekte im Ausland – u.a. in Liberia, im Libanon und in Israel. Zwischen 2008 und 2009 arbeitete er für die humanitäre Hilfsorganisation Cap Anamur in der einzigen psychiatrischen Klinik Liberias. Neben seinen Romanen – wie Lichtjahre entfernt, der 2009 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand – veröffentlicht Merkel auch Reportagen; beispielsweise über die Ebola-Epidemie in Liberia, für die er vor Ort bei einer lokalen NGO recherchierte. 2013 erhielt er den Erich-Fried-Preis.
Seine Bücher
„Eine engagierte Literatur gibt es nicht.“ – sagte Peter Handke. Dabei kann Literatur unsere Gegenwart in Sprache hüllen sowie manchen Mantel des Schweigens lüften. Sie kann Welten erzählen, spiegeln, hinterfragen sowie neu denken und diskutieren. Dass dieser gesellschaftliche Anspruch nicht etwa mit einer moralischen Überlegenheit einhergeht, zeigen die Texte von Rainer Merkel. Mit ihm habe ich über ethische Chancen und Grenzen beim Schreibprozess sowie über die Verortung von Literatur zwischen Fakt und Fiktion gesprochen.

Ein Gespräch mit Rainer Merkel – Teil I
Ihr literarisches Werk ist formal vielfältig – Romane, berichtende Texte und Reportagen. Welche Erzählformen halten Sie für die Gegenwart, um beispielsweise aus der ‚Erregungskultur‘ herauszustechen, für adäquat? Welches Potenzial schreiben sie reportageartigen sowie klassisch fiktionalen Genres wie dem Roman beim Erzählen einer krisenhaften Gegenwart zu?
Rainer Merkel: Mit einer Reportage kann man schnell sein und auf ein aktuelles Thema direkt Bezug nehmen. Im Vorfeld zu Go Ebola Go fand ich die Berichterstattung über die Ebola-Krise absolut nicht in Ordnung. Diese hatte für mich fast etwas Pornografisches: Die Menschen wurden auf ihren Opfer- und Krankheitsstatus reduziert; die Berichterstattung war fokussiert auf die Heldentaten der internationalen Gemeinschaft, während viel weniger berücksichtigt wurde, was auf lokaler Ebene geleistet wird. Deshalb wollte ich mir selbst vor Ort ein Bild verschaffen. Ich war vorher schon einige Male in Liberia und eine Reportage war das beste Mittel. Dabei war für mich aber wichtig, dass meine Subjektposition mitthematisiert wird sowie dass der Text möglichst transparent die Methoden der Recherche offenlegt.
Erinnerung als Brennglas
Wenn man einen Roman schreibt, nimmt man eine andere Position und andere Haltungen ein. Es sind zwei Formen, die eigentlich relativ weit voneinander entfernt sind. Für eine Reportage ist es besser, wenn man sie unmittelbar nach dem Erleben aufschreibt. Denn wenn man zu lange wartet, kann man zwar noch auf die Notizen zurückgreifen, aber der Bezug geht etwas verloren. Wenn ich jetzt beispielsweise über die schwedische Journalistin schreiben würde, mit der ich in Liberia für die Arbeit an Go Ebola Go unterwegs war, würde das Thema Angst noch viel mehr in den Vordergrund treten. Als ich zum Beispiel ein Taschentuch aus ihrem Rucksack holen musste, weil sie keine Hand mehr frei hatte, da sie das an einer langen Teleskopstange befestigte Mikrofon einem Interviewpartner ins Gesicht hielt. Ich erinnere mich an die Panik, dass wir irgendetwas falsch machen, irgendetwas anfassen könnten. Ich weiß nicht mehr, ob diese Szene im Text eine große Rolle gespielt hat, aber wenn ich das aus der Erinnerung heraus noch mal aufschreiben würde, würde dies mehr in den Vordergrund rücken.
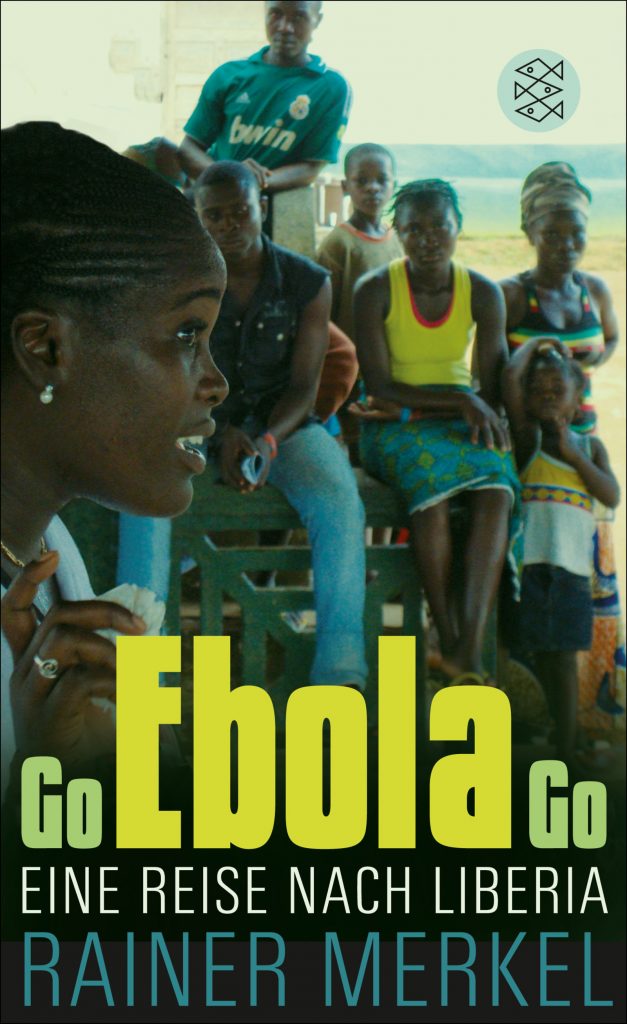
Die Erinnerung vergrößert und verzerrt Dinge, was für das Schreiben von fiktiven Texten hilfreich ist – aber nicht für eine Reportage, die dann leicht aus der Balance gerät. Beim Roman geht es eher darum, Lücken und Leerstellen auszufüllen, die dadurch entstanden sind, dass die Erinnerung unser Denken manipuliert.
Texte als erzählte Wirklichkeit
Ist dann eine bestimmte Erzählform angemessener, um gegenwärtige Krisenerfahrungen zu beschreiben?
Rainer Merkel: Das würde ich nicht sagen. Es kann sein, dass ein Roman, der ein bestimmtes Krisenereignis thematisiert, besser gelingt als die Reportage. Bei der Reportage fehlt manchmal auch der Abstand. Dann ist man zu nah dran und es wird unmittelbarer und emotionaler. Gleichzeitig kann sich dabei eine gewisse Blindheit für größere Zusammenhänge einstellen und man verliert sich schnell in Mikro-Wahrnehmungen.
Welchen Eigenwert hat das Ästhetische, wenn sich fiktionales und faktuales Erzählen überschneiden? Welche Rolle spielt die Fiktionalität?
Rainer Merkel: Das ist für mich deutlich voneinander getrennt. Zwischen einem Roman und einer Reportage liegen Welten – bezogen auf den Schreibprozess. Bei Stadt ohne Gott zum Beispiel habe ich einen Text verarbeitet, den ich ein paar Jahre zuvor für das Kursbuch über das schiitische Aschura-Ritual geschrieben hatte.

Jede Erzählung ist Konstruktion
Ich hatte die Idee, im Roman eine Figur an diesem Aschurafest teilnehmen zu lassen. Es war für mich ungewohnt, einen schon fertigen Text noch mal anzusehen, um Teile daraus für einen Roman zu verwenden; das war für mich beinahe eine Kannibalisierung, da ich versucht habe, diesen Text wieder zu ‚öffnen‘ und Dialoge zu schreiben, die nun rein fiktiv waren. Das war ziemlich kompliziert und ich würde es nicht noch einmal machen, weil beide Textformen nicht unbedingt kompatibel sind. Einen abgeschlossenen Text noch mal zu ‚reanimieren‘, ist heikel.
Ich erinnere mich, dass ich hierfür vor Ort Notizen gemacht hatte, weil die Verwendung eines Aufnahmegeräts schwierig war. Wenn man sich bei einem Gespräch nur Notizen macht, kann die Wiedergabe des Dialogs sowieso nie hundertprozentig sein. Am Ende ist das, was man schreibt, immer eine Konstruktion, weil man eine Auswahl trifft und immer nur Teile des Gesprächs wiedergibt. Deswegen ist es mir wichtig, das im Text zu ‚markieren‘, sodass Lesende merken, dass es sich hierbei um eine subjektive Wahrnehmung handelt. Damit wird der Objektivitätsanspruch des Journalismus‘ infrage gestellt, aber auch klar gemacht, dass eine Reportage auch eine Erzählung ist – und zwar eine ‚erzählte Wirklichkeit‘ und kein genaues Abbild der Wirklichkeit.
Literatur als Annäherung an die Wirklichkeit
Als ich beispielsweise im Rahmen des liberianischen Wahlkampfs 2011 in Liberia zusammen mit einem Reuter-Journalisten ein Gespräch mit dem ehemaligen Rebellenführer Prince Johnson geführt habe, hat uns dessen Mitarbeiter am Ende einen Umschlag gegeben. Da hatten wir unsere Notizbücher natürlich schon längst weggesteckt; wir waren schon im Modus der Verabschiedung. Es war aber trotzdem ein wichtiger Moment. Denn in dem Umschlag befand sich Geld. Das war in Liberia damals nicht ungewöhnlich, da die lokalen Journalist:innen so wenig verdienen, dass sie sich oft nicht einmal die Fahrtkosten leisten können.
Die spannende Frage ist aber natürlich, was der Mitarbeiter genau gesagt hat. Vielleicht: „Hier habt ihr einen Umschlag mit Fahrgeld.“ Oder: „Hier, das ist ein Umschlag für euch“. Das macht einen großen Unterschied. Wenn man diese Szene wiedergibt, muss dies möglichst so passieren, wie es vermutlich gedacht war – dass es nämlich kein Bestechungsversuch war, sondern ein in Liberia gar nicht ungewöhnlicher Vorgang. Aber so genau kann man es eben doch nicht sicher sagen, weil wir das Geld nicht angenommen haben und also nicht wussten, wie hoch der Betrag war: lediglich Fahrgeld oder doch ein bisschen mehr?
Allein aus Solidarität zu den anderen liberianischen Journalist:innen, hätten wir es vielleicht aber annehmen sollen. Ein Journalist, den ich kenne und der für The Democrat – eine der damals bekanntesten Zeitungen in Liberia – geschrieben hat, musste diese Arbeit eigentlich wie ein Hobby betreiben und sein Geld als Zimmermann und Schreiner verdienen. Er hat Regale entworfen, Dächer repariert und naja, auch Särge gebaut, wenn es notwendig war.
Literatur soll irritieren
Wie verstehen Sie das Verhältnis von Engagement und Literatur? Kann Engagement der Literatur im Weg stehen, beispielsweise wenn der Text zum Instrument einer Botschaft wird?
Rainer Merkel: Auf der literarischen Seite ist die Engagement-Frage auch eine Frage danach, welche Perspektive man einnimmt. Bei Das Jahr der Wunder ging es um eine Agentur in der New Economy Ende der 90er Jahre. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich eine Idee entwickelt hatte, welche Funktion der Text für mich haben könnte. Ob es auch eine politische Ebene gibt und ob es vielleicht darum gehen könnte, aufzuzeigen, wie in den neoliberalen Arbeitsstrukturen externer Druck internalisiert wird; wie sich das Individuum selbst hierarchisiert, um externen Ansprüchen besser gerecht zu werden. Das hat sich erst im Schreibprozess herauskristallisiert und kann nicht auf dem Reißbrett geplant werden. Wie die Hauptfigur auf diese Selbstausbeutungseuphorie in der New Economy reagiert, wird im Text nicht bewertet; es bleibt im Raum stehen, sodass man sich als Leser:in eine eigene Meinung bilden kann.
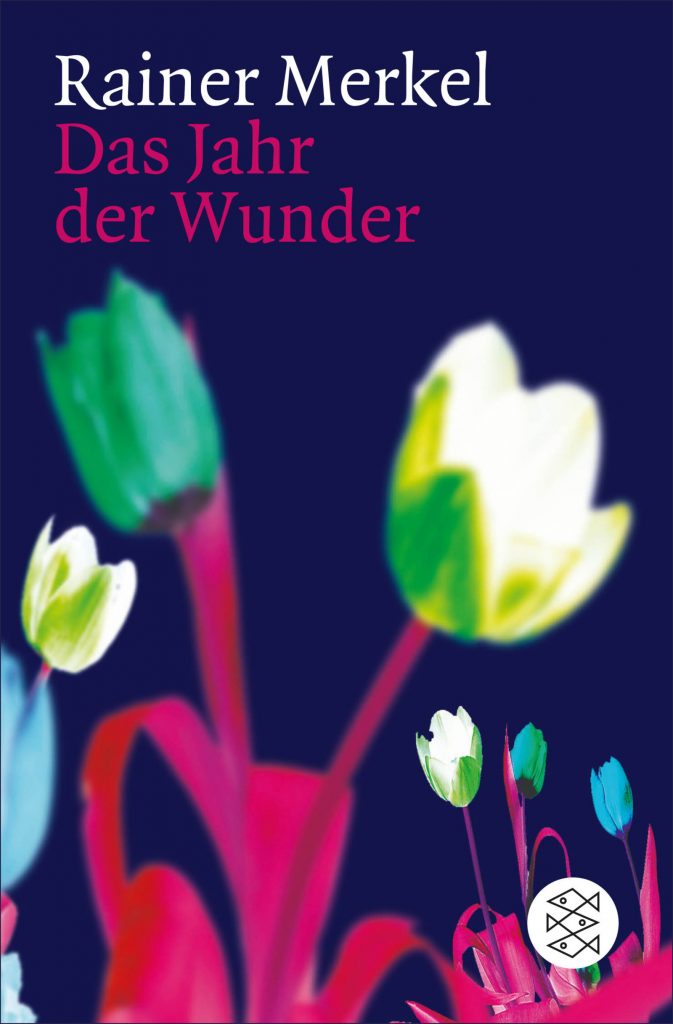
Emanzipation vom Engagement
Bei Bo war das ähnlich. Da ging es zunächst auch nicht direkt um die NGO-Thematik. Ausgangspunkt war eine Geschichte über einen blinden liberianischen Jungen. Als dann eine andere Perspektive dazu kam, nämlich die von Benjamin, der seinen Vater in Liberia besucht, änderte sich auch das Thema. Es ging dann zudem um die Frage, was Benjamin aus der Erfahrung mit seinem liberianischen Freund lernt und ob ihn das auch verändert. Solche Sachen laufen bei der Recherche mit; was aber nachher im Text davon übrig bleibt, weiß man vorher oft nicht. Die Figuren emanzipieren sich dabei von solchen ‚Engagement-Gedanken‘. Sie nehmen als Figuren keine Rücksicht darauf, was sich der:die Autor:in am Anfang überlegt hat. Unterhaltungsliteratur ist demnach die ‚engagierteste‘ Literatur überhaupt: Ganz viele Autor:innen in diesem Bereich haben den Anspruch, ganz explizit zu einem bestimmten Thema zu schreiben und die Literatur ist für sie dann tatsächlich ein Instrument. Bei so einem Ansatz müssen die Figuren ‚mitmachen‘. Sie müssen sich unterordnen. Sie sind die Erfüllungsgehilfen von Plot und Botschaft. Als Leser:in bekommt man das oft nicht mit, weil man sich mit den Figuren identifiziert.
Intuitive Literatur untersagt Engagementsabsicht
Ich finde es aber interessanter, wenn die Figuren eigenständiger und weniger berechenbar sind. Dann entsteht aus den Figureninteraktionen und Erzählbewegungen eine Komplexität, die man als Autor:in selbst nicht mehr kontrollieren und nur noch intuitiv steuern kann. Trotzdem stellen Texte auch immer eine Zurichtung der Wirklichkeit da. Sie können mitunter ‚totalitäre Züge‘ annehmen, wenn das erzeugte System zu geschlossen ist. Deswegen muss man Störgeräusche zulassen und sich selbst als Meta-Instanz immer wieder ins Wort fallen. Allein schon deswegen verbietet sich der Gestus des Engagements, der Anspruch moralischer Überlegenheit. Denn wenn die Figuren nur das tun, was man sich für sie ausgedacht hat, dann fehlen die Irritation und das Staunen, das gute Literatur für mich immer ausmacht.
Fortsetzung folgt …
Das Interview gibt es auch auf schauinsblau.de

